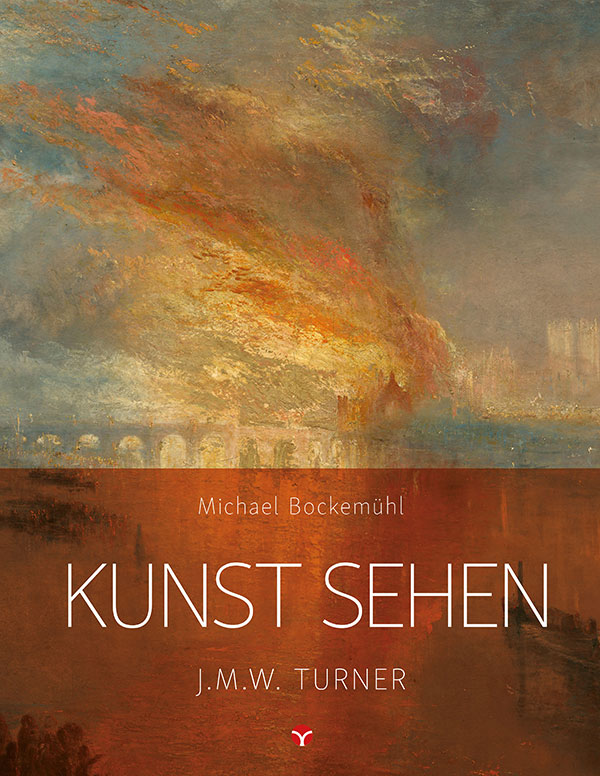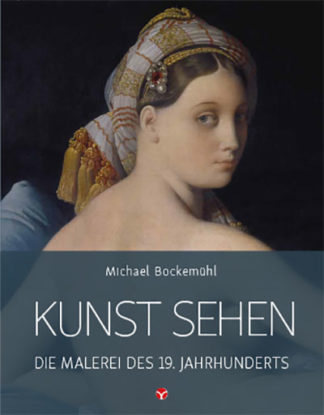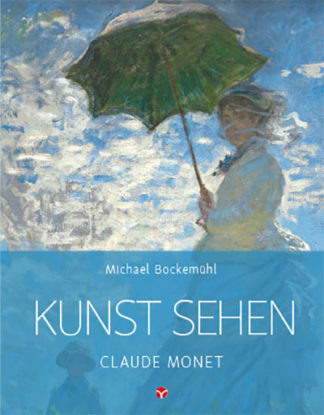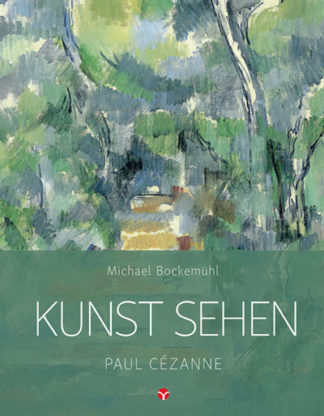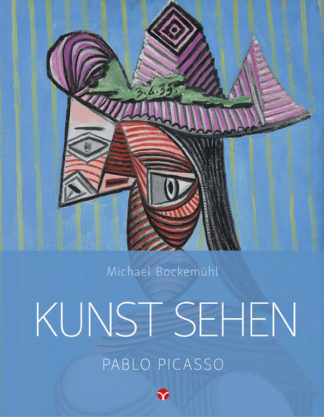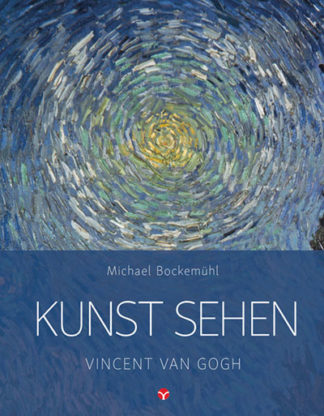Der versierte Kunstwissenschaftler und Wahrnehmungsforscher Michael Bockemühl nimmt uns im 15. Band der Reihe KUNST SEHEN mit in die Welt Turners. Eines Künstlers, der seiner Zeit weit voraus war und uns dazu anregt, über das Bild hinaus zu denken.
„Interbrettation“ nannte Michael Bockemühl die Tendenz, Kunstwerke qua Interpretation zu schubladisieren. Denn eine solche Vorgehensweise vernagelt nicht allein die Wahrnehmung, sondern suggeriert auch einen soliden Stand, wo möglicherweise keiner ist. William Turner (1775–1851) war bereits in jungen Jahren Meister der Licht- und Luftperspektive, der akkuraten Zeichnung wie des Atmosphärischen. Er öffnet die Wahrnehmung auf eine Weise, die den Betrachtenden den Boden unter den Füßen wegziehen kann.
„Zu beobachten, wie Turner die Welt durch eine bestimmte Weise der Farbgestaltung bildnerisch zur Erscheinung bringt, kann sich heute zugleich als ein Zugang zu unserem eigenen bewussten Sehen der Welt erweisen. Seine Farbgestaltung gibt Anlass, uns deutlicher bewusst zu machen, wie wir sehen. Sie zu beobachten ist nicht allein für Turners Kunst aufschlussreich. Diese Beobachtungen betreffen zugleich unser Wahrnehmen selbst und führen damit zu den Grundfragen der Ästhetik.”
Michael Bockemühl
Seine Malerei ist weniger vom Gegenstand bestimmt als von der Erforschung der Wahrnehmung, die den Gegenstand in Erscheinung treten lässt. Ohne Goethe gelesen zu haben, dessen Farbenlehre ihm später eine Offenbarung wurde, nutzt Turner die in der Physiologie begründete Tätigkeit des Auges für seine Malerei: Nachbildeffekte durch Farbkontraste etwa lassen einen Sonnenuntergang erlebbar, Feuer spürbar und Wetterphänomene lebendig werden. Die Wirkstrukturen des Auges werden durch den gezielten Einsatz von Farbe aktiv, steigern die Sujets seiner Malerei auf verblüffende Weise und kündigen die Autonomie des Werkes an.
Michael Bockemühl war Kunstwissenschaftler, Hochschullehrer, Vortragsredner und Berater großer Unternehmen. In jüngeren Jahren war er als Waldorf- und Sonderschullehrer tätig, später bei der GLS Bank in Bochum. Ab 1985 arbeitete der vierfache Familienvater eine Zeit lang als Kulturmanager für die Anthroposophischen Gesellschaft, bevor er 1990 an die Universität Witten/Herdecke berufen wurde.
Diese auf 20 Bände ausgelegte Edition geht auf eine viel beachtete öffentliche Vorlesungsreihe zurück, die Professor Michael Bockemühl Anfang der 1990er Jahren im Saalbau Witten hielt. In seinen Diavorträgen nimmt der Redner gemäß seinem Credo: „Der Künstler ermöglicht, was der Anschauende verwirklicht“ sein Publikum gleichsam bei der Hand und führt es zu den einzelnen Kunstwerken hin. Dabei werden weder Spekulationen über ihre möglichen Bedeutungen angestellt, noch abstrakte Theorien über das Sehen geschmiedet, vielmehr feiert der Autor ein „Fest für das Auge“: Mit Witz und methodischer Konsequenz versteht es der passionierte Wahrnehmungsforscher die Aufmerksamkeit auf die durch nichts anderes als durch das Kunstwerk eröffneten Anschauungsmöglichkeiten zu lenken.
Die Bände werden herausgegeben von Dr. phil. David Hornemann v. Laer (Zentrum Studium fundamentale) in Zusammenarbeit mit Birgit Bockemühl sowie Studierenden an der Universität Witten/Herdecke.
Die Reihe „Kunst sehen“ kann zu einem vergünstigten Preis pro Band (€ 14,80) im Abonnement bezogen werden. Das Abonnement können Sie auf unserer LandingPage KUNST SEHEN bestellen.
Eine schöne Rezension des Buches in der erziehungskunst 11/2024 von Gabriele Hiller:
Rätselhaftigkeit und Atmosphäre
Die auf 20 Bände angelegte transkribierte Vorlesungsreihe KUNST SEHEN von Michael Bockemühl ist mittlerweile weit fortgeschritten und mehr denn je gilt: Jedem Künstler kommt Bockemühl auf andere, passende Weise nahe, so dass jedes Mal eine individuelle Erfrischung des Sehvorganges und der daraus resultierenden Bildwirkung stattfindet und die Lesenden einen nachhaltigen Schatz an Herangehensweisen erhalten.
Es gelingt Bockemühl eine Gegenwärtigkeit herzustellen, als sähe man diese Werke das erste und entscheidende Mal. Seine Frage lautet: Was geschieht zwischen mir und dem Werk? Kann ich mein Sehen als höchste Aktivität und entscheidende Realität begreifen? Den Weg William Turners (1775 – 1851) skizziert Bockemühl anhand einzelner Bilder vom könnerhaften darstellerischen Frühwerk bis zu den feinsten atmosphärischen Farbgebilden der späten Jahre. Die Unbestimmtheit der Gemälde ab den 1830er Jahren erweist sich als hohe Qualität. Turner wollte Offenheit und Rätselhaftigkeit, der Atmosphäre einer Situation sowie flüchtigsten Bewegungen eine adäquate Form verleihen.
Bockemühls methodische Hinweise um vom vorstellenden, begrifflichen Deuten des Motivs zum individuellen Sehen zu gelangen, sind dabei außerordentlich hilfreich und für den Lesenden ein kostbares Instrumentarium, weit über Turner hinaus. Welch ein Sprung beispielsweise zwischen dem narrativen Titel «Das Kriegsschiff Temeraire wird zu seinem letzten Ankerplatz geschleppt…» von 1838/39 und der Wirkung dieses Werkes als Farbereignis. Interessant auch der Hinweis, dass Goethes Farbenlehre 1840 ins Englische übersetzt und drei Jahre später Turner geschenkt wurde. Bockemühl vermag konkret an Bildern zu zeigen, wie Turner das Erscheinen der Farbe zwischen Licht und Finsternis gestaltet und Naturprozesse zu Bildprozessen werden lässt, die den Betrachtenden unmittelbar in Geschehen wie die untergehende Sonne oder schäumendes Meer hineinzuziehen vermögen.